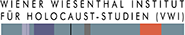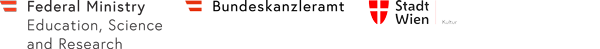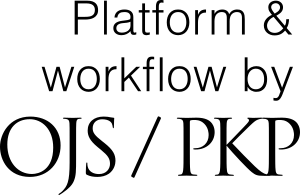Thomas Mann ohne Juden
Vergangenheitspolitik im westdeutschen Nachkriegskino
Keywords:
Thomas Mann, die deutsche Kulturnation, die älteren Traditionen von der NS-Vergangenheit, Rezeptionsgeschichte, populärkulturelle Aufbereitung, Film, jüdische FigurenAbstract
Kein Repräsentant der deutschen Kultur eignete sich besser, das Gründungsnarrativ der Bundesrepublik zu beglaubigen, als Thomas Mann. Als Exilant war er über jeden Zweifel erhaben, mit dem NS-Regime sympathisiert zu haben. Als Amerikaner mit schweizerischem Wohnsitz ließ er sich leichter für das westliche Lager vereinnahmen als beispielsweise sein Bruder Heinrich. Als Nobelpreisträger und international hochgeachteter Autor verkörperte er die deutsche Kulturnation. Als Angehöriger der Großvätergeneration stand er für ein besseres Deutschland, dessen Traditionen weit hinter den Jänner 1933 zurückreichten und an die die Bundesrepublik anzuknüpfen versuchte. Das Bedürfnis, in der Gestalt Thomas Manns diese älteren Traditionen von der NS-Vergangenheit zu lösen, lässt sich auch und gerade an der wissenschaftlichen Rezeption Manns vorführen. Noch folgenreicher dürfte aber die populärkulturelle Aufbereitung des Autors gewesen sein, die Transposition seines Œuvres in das Massenmedium Film. Thema des Vortrags ist, wie die jüdischen Figuren seiner Romane und Novellen in den Nachkriegsverfilmungen sukzessive zum Verschwinden gebracht wurden bzw. verschwunden sind.
Downloads
Abstract View:
544pdf downloads:
386Published
How to Cite
Issue
Section
License
S:I.M.O.N. operates under the Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND (Attribution-Non Commercial-No Derivatives). This allows for the reproduction of all articles, free of charge, for non-commercial use, and with appropriate citation information. Authors publishing with S:I.M.O.N. should accept these as the terms of publication. The copyright of all articles remains with the author of the article. The copyright of the layout and design of articles published in S:I.M.O.N. remains with S:I.M.O.N. and may not be used in any other publications.